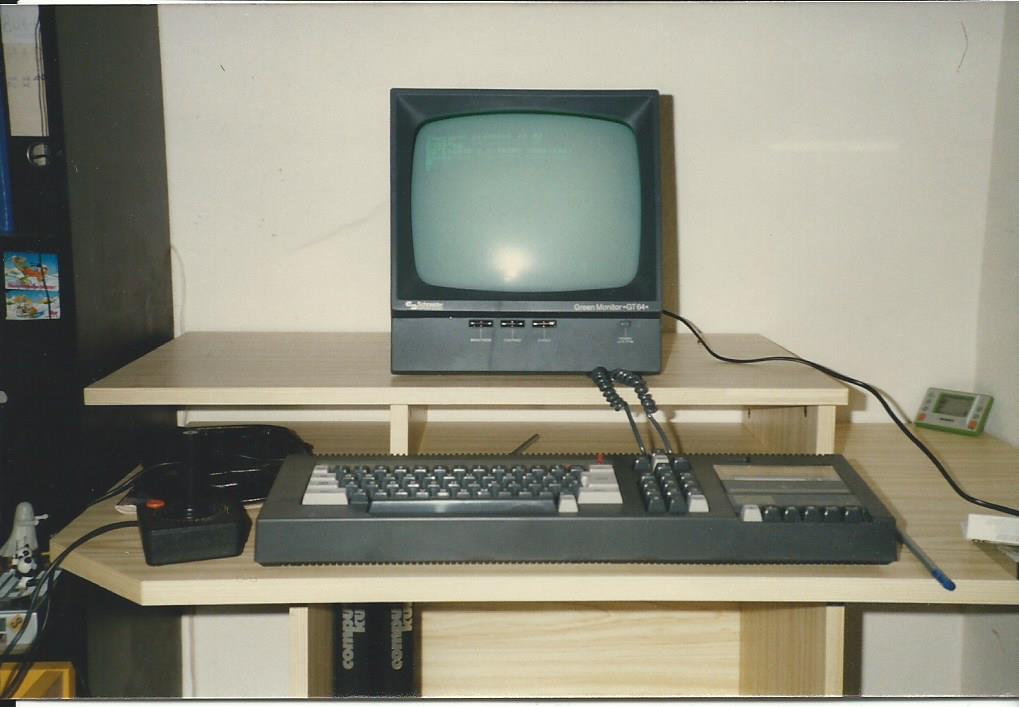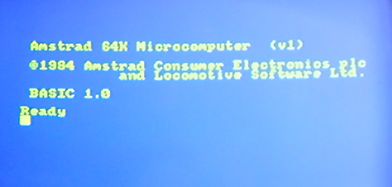Wie angekündigt geht es nun weiter mit Hörspiel-Rezensionen. Heute möchte ich meinen Blick den STAR-WARS-Hörspielen zuwenden.
Wie ich schon in dem anderen Bericht angemerkt hatte, gab es in den 1970er und 1980er Jahren noch keine oder noch nicht so viele Videorekorder und die Zweitvermarktung von Kinofilmen für den Fernseher steckte noch in den Kinderschuhen. In dieser Zeit etablierte sich das „Hörspiel zum Film“, das in einigen Fällen parallel zum Film herauskam, meistens jedoch etwas später. Dabei wurde meistens die Original-Tonspur des Films verwendet und mit einem Erzähler ergänzt.
Mein persönliches erstes STAR-WARS-Hörspiel, das ich auch immer noch besitze, ist eine Langspielplatte mit dem Titel „Krieg der Sterne (The Story of Star Wars)“. Als Erzähler fungiert hier F. J. Steffens und der Text ist manchmal etwas eigenwillig, etwa wenn er R2D2s „Sprache“ als „Krks und Tschieps und Rks und Pieps“ bezeichnet oder Chewbacca als „Hundemensch“. Vielleicht entstand aber so die Inspiration für den „Möter“ aus Mel Brooks‘ „Spaceballs“.
Doch ansonsten ist es sehr stimmungsvoll, manchmal etwas übertreibend, etwa wenn die Explosion des Todessterns am Schluss als „Lichtball, wie ihn hundert Sonnen nicht erschaffen können“ beschrieben wird.
Um auf Schallplattenlänge zu kommen, musste natürlich einges des ursprünglich über 2 Stunden langen Filmes eingekürzt werden, aber das geschah sehr geschickt und fällt nicht weiter auf.
„Das Imperium schlägt zurück“, die Fortsetzung, erscheint mir manchmal so ein wenig wie das „Stiefkind“ der Reihe, denn so sehr ich auch gesucht habe, ich fand nie ein Hörspiel zu diesem Film. Mit einer Ausnahme: Ein Verlag für Kleinkind-Hörspiele (!!) adaptierte den Film zu einem „Lesen und Hören“-Erlebnis. Dabei wurde die Handlung auf 20 Minuten (!!!) gekürzt und von komplett anderen Sprechern aufgenommen. Dadurch kam es zu mancher Merkwürdigkeit, etwa als Darth Vader die Kopfgeldjäger ganz höflich als „meine Herren“ bezeichnet.
„Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ wurde wiederum bearbeitet, es handelt sich hierbei um eines jener „legendären“ Hörspiele mit Erzähler Volkert Kraeft. Legendär sind an diesen Hörspielen die Erzähltexte von Petra Schmidt-Decker, gepaart mit Volkert Kraefts mitreißender Art zu erzählen. So wird der Hörer gleich zu Beginn darüber aufgeklärt, worum es in der Geschichte geht: „Krieg! Krieg! Krieg! Krieg ist Kampf! Um Macht! Macht aber wird von Macht bestimmt, und über jedem, der sie besitzt, gibt es einen, der noch mehr hat; einen, der nicht genug bekommen kann; einen, dessen Größenwahn die Auslöschung der anderen fördert! Macht… positiv genutzt ist Macht Energie… Kraft… Bewegung… Negativ genutzt führt sie zur Unterdrückung… zum Kampf… zum Krieg. Dieser letzte Krieg, der Krieg in der Galaxis, ist der KRIEG DER STERNE…“. Da es auf Kassette erschien, war man nicht an die Grenzen einer Schallplatte gebunden und die Schnitte in der Handlung waren begrenzt.
Den kraftvollen Texten von Petra Schmidt-Decker verlieh Volkert Kraeft besondere Gestalt, beispielsweise als er bei der berühmten Speeder-Bike-Jagd mit Luke und Leia im Wald von Endor die Worte so schnell sprudeln lässt, dass man den Eindruck hat, er sitzt direkt hinter Luke auf dessen Speeder-Bike und moderiert live mit.
Im Rahmen der Neubearbeitung der ursprünglichen Trilogie und dem Erscheinen von Episode I bis VI machte sich nun WORTART auf, alle Filme neu als Hörspiel zu bearbeiten . Oliver Döring, der auch die Hörspielbearbeitung von „Labyrinth des Bösen“ machte, zeichnet für den Text verantwortlich, als Erzähler wurde Joachim Kerzel, der unter anderem Synchronsprecher von Jack Nicholson ist, verpflichtet. Im Gegensatz zu „Labyrinth des Bösen“, das auf 3 CDs verteilt ist, wurde jedoch hierbei ein Film auf eine CD gebannt. Bei maximal 80 Minuten Laufzeit bedeutet das zwangsweise, dass Dinge eingekürzt werden müssen. Zunächst betrifft das natürlich alle Passagen, die sehr visuell sind, wie etwa Raumschlachten. Daneben wurden kleine Nebenhandlungen entfernt, wie Han Solos Begegnung mit Greedo in Episode IV oder Solos und Chewies Schießerei mit dem imperialen Suchdroiden in Episode V (der Schnitt wurde hier so geschickt gemacht, dass es sich anhört, als würde Leia auf dem Display erkennen, dass es sich bei dem fremden Objekt um einen imperialen Suchdroiden handeln).
Der Text dieser Bearbeitung wurde mit viel Sachverstand angegangen, Namen von Personen und Bezeichnungen von Geräten oder Fahrzeugen, die im Film nicht ausdrücklich genannt werden aber den Fans bekannt sind, sind korrekt verwendet. Der Text beschreibt die Situationen, so weit es nötig ist und ist meiner Meinung nach nicht aufdringlich. Und da WORTART die ganze Serie herausgebracht hat, ist eine Kontinuität vorhanden, bis auf zwei Kleinigkeiten: die Titel. Episode I bis III wird vom Sprecher als „STAR WARS Episode…“ vorgestellt, das Cover von CD und CD-Box ist entsprechend gestaltet, Episode IV bis VI wird als „Krieg der Sterne. STAR WARS, Episode…“ bezeichnet und die Schriftzüge auf CD und CD-Box sind nach den alten Kinofilmen gestaltet.
Alles in allem ist die Bearbeitung sehr gelungen und wie ich schon in meiner Rezension von „Labyrinth des Bösen“ vermerkte, hoffe ich, dass das nur der Anfang einer Reihe sein wird, die noch kommt. Der Möglichkeiten gibt es viele („Schatten des Imperiums“, „Erben des Imperiums“ etc.)…