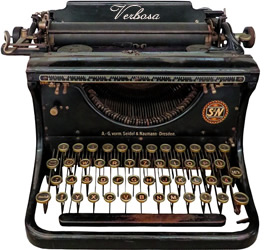Tim und Struppi: Der Arumbaya-Fetisch [Rezension]
1935 wurde die Situation in Europa immer instabiler. Das änderte jedoch nichts an Hergés Interesse für die internationale außereuropäische Politik. Inspiriert von dem Krieg zwischen Bolivien und Paraguay entwirft er eine Geschichte, die vor dem Hintergrund eines solchen Krieges um ein Erdölgebiet spielt. Allerdings führt er eine weitere Neuerung in …