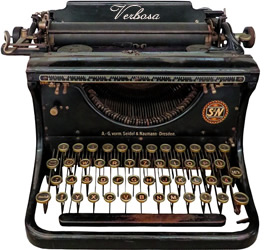7. Januar 49 v. Chr.: Der Römische Senat beauftragt Pompeius mit der Verteidigung Roms gegen den am Rubikon lagernden Julius Cäsar
Im 1. Jahrhundert vor Christus befand sich die Römische Republik in der Krise. Diese Krise hatte ihre Ursache paradoxerweise hauptsächlich in den militärischen Erfolgen. Der Aufstieg Roms zur beherrschenden Macht des Mittelmeerraums und die enorme Vergrößerung seines Staatsgebiets erzeugte tiefgreifende soziale Spannungen zwischen verschiedenen Interessengruppen des Reiches: den adeligen Großgrundbesitzern, …