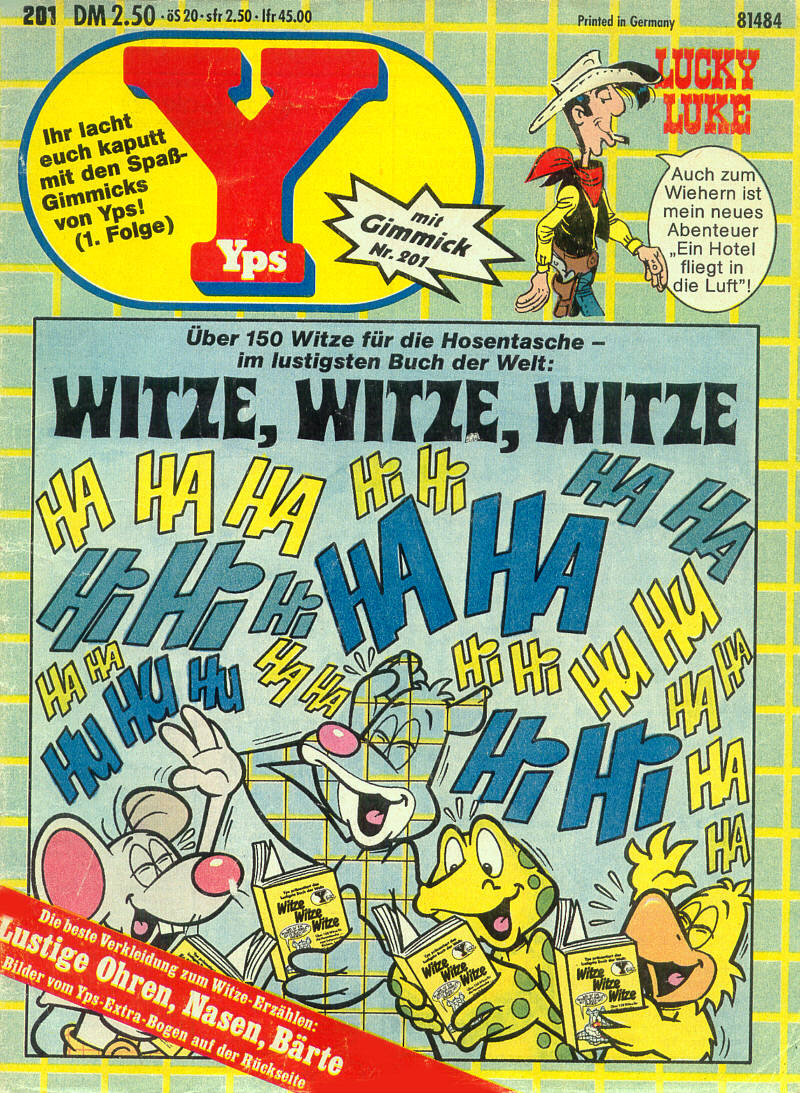Wenn man im Rettungsdienst arbeitet, hat man beruflich auch mal wieder mit der Polizei zu tun. Bei Unfällen und natürlich Straftaten ist sie immer mit vor Ort. Wenn wir mitten auf der Straße einem verunglückten Motorradfahrer helfen, sorgt sie dafür, dass kein gaffender Autofahrer über uns drüber fährt, sie ermitteln Personalien und nehmen Spuren auf.
Nun hatte ich die Gelegenheit, auch mal eine andere Seite kennenzulernen. Nicht dass ich mich darum gerissen hätte, aber leider musste es sein, dass ich bei der örtlichen Polizei-Dienststelle vorstellig werde und meinen Fall vorbringe. Worum es ging? Offenbar ist ein behördlich nicht ganz unbekannter Jung-Unternehmer mit Namen K. über einen Hostingservice an eine Menge Adressdaten gekommen. Das Resultat davon war, dass auch ich (so wie eine Menge anderer Menschen, die sich im Internet tummeln) eine eMail erhielt, in der mir für meine „Bestellung“ gedankt wurde und dass ich binnen einer gewissen Frist einen Betrag von 109,90 Euro zu zahlen habe, damit ich meine (Zitat) „10 Top DVDs“ möglichst bald bekomme. Nach dem ersten Schreck und einer genaueren Betrachtung der angegebenen Seite, auf der ich angeblich die Bestellung getätigt habe kam ich zu dem Schluss, dass hier offenbar Betrug vorliegt. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mir noch nicht erklären, wie K. an meine Adresse gekommen ist, aber so viel hätte da gar nicht dazu gehört: Wenn ich jemandem was böses gewollt hätte, dessen Adresse und eMail ich kenne, hätte diese Daten einfach in einem Formular auf der Seite eintragen können, ein Häkchen hinter „AGBs akzeptieren“ machen – abschicken – fertig! Dann hätte auch diese Person eine „nette“ Rechnung gekriegt.
Die Mail und die als PDF angehängte Rechnung hatten eine gewisse Raffinesse: es wurde behauptet, ich hätte die Bestellung vor ungefähr einem Monat gemacht, mein 14tägiges „Rücktrittsrecht“ von dem Vertrag war damit längst verstrichen.
Dann habe ich etwas im Internet gesucht und bin auf verschiedene Foren gestoßen. Zum einen durfte ich feststellen, dass K. kein unbeschriebenes Blatt ist, diese Masche ist seine dritte, vierte oder fünfte Abzocke (die letzte große Aktion fand im März diesen Jahres statt). Zum anderen las ich, dass es vielen Leuten genau so gegangen ist wie mir und so langsam kristallisierte sich heraus, aus welcher Quelle K. die Adressen hatte. Tatsächlich landete die Rechnung nicht in meinem „regulären“ Mailfach, sondern in einem, das ich nur für ein ganz bestimmtes Projekt verwende. Darin ist ein Hostingservice verwickelt, der aber seinerseits offenbar von K. betrogen worden zu sein scheint und nun selber Schritte gegen diesen Herrn – der offenbar übrigens ein „UZWA“ (=“unter zwanzig“) ist – eingeleitet hat.
In einigen Foren wurde auch der Ansprechpartner der zuständigen Polizeibehörde für Herrn K. genannt und es wurde empfohlen, eine Anzeige wegen versuchten Betrugs zu machen. Genau dieses habe ich dann gemacht. Der Beamte vom örtlichen Polizeirevier war sehr freundlich und hat meine Anzeige aufgenommen. Allerdings war da ein merkwürdiges Gefühl für mich dabei. Ich weiß nicht warum, aber es kam mir so vor, als würde ich jemanden „in die Pfanne hauen“. Jemandem die Ermittlungsbehörden auf den Hals zu hetzen ist schon eine harte Sache. Aber ich musste mich auf der anderen Seite daran erinnern, dass hinter dem, was K. tut, eine starke kriminelle Energie steckt. Laut dem Betreiber des Hostingservice hatte K. womöglich Zugriff auf bis zu 40.000 Adressen. Egal wieviele davon er angeschrieben hat, wenn davon nur 100 im ersten Schreck zahlen, sind das schon 10.990 Euro, die auf K.s Konto gespült werden. In einem Forum habe ich ein Gespräch zu einer früheren Masche mit ihm gelesen, in dem er unverblümt zugibt, er brauche Geld für sein Projekt und (Zitat) „es ist mir egal, woher das Geld kommt.“ (Vollständiger Text zum Thema „Der Beschiss liegt darin, dass man Scheiß kauft“ siehe hier!)
Auch logisch betrachtet ist das ganze leicht zu entlarven: Wer würde denn für 109,90 Euro eine „DVD-Wundertüte“ kaufen? Auf der Seite wurden zwar die Cover einiger DVDs eingeblendet, aber was man da zum Beispiel kriegen könnte, wurde im Text nicht erwähnt. Noch dazu, da es in den AGBs hieß, man habe keinen Anspruch auf ein bestimmtes Produkt. Woher will ich dann wissen, dass ich von den 10 DVDs, die ich dann kriege, nicht schon 8 habe? Und der Gipfel: einige Leute in den Foren, in denen über diese Masche diskutiert wurde, gaben an, noch nicht einmal einen DVD-Player zu besitzen.
Mir persönlich hat es sehr geholfen, dass der Polizeibeamte sich in Ruhe und ohne Stress hingesetzt hat, zuerst habe ich ihm geschildert, was war und was ich im Internet erfahren und herausgefunden habe, dann hat er meine Personalien und den Fall aufgenommen. Er unterstützte es auch und meinte, diesen Leuten könne man nur beikommen, wenn sich möglichst viele bei der Polizei melden, denn wenn das nur drei oder vier tun, stellt sich das dem Staatsanwalt womöglich wie eine technische Panne dar, wie sie im Internet nun mal passieren könne. Inzwischen gilt mein Mitgefühl dem Beamten der zuständigen Polizeibehörde in H., der schon bei den vorigen Abzock-Versuchen viel aufzunehmen hatte und jetzt schon wieder massenhaft Anzeigen bearbeiten darf. Und das alles wegen einem „Jungunternehmer“, der so dringend Geld braucht, dass es ihm egal ist, wo es herkommt und der offenbar den Hals nicht vollkriegt.
Ich persönlich hoffe, dass ich nicht so bald wieder in die Verlegenheit komme, Anzeige gegen jemanden erstatten zu müssen. Aber manchmal muss es eben sein. Schade, dass Vernunft und menschliches Miteinander es nicht ermöglichen, ohne auszukommen. Da haben die Menschen noch einen weiten Weg vor sich.
Eine Zusammenfassung zu dem Fall findet sich auf der Seite dialerschutz.de.