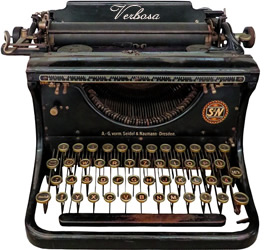“Netter Planet, den nehmen wir!” – Erde macht mobil…
Das privat finanzierte Raumfahrtprojekt “Mars One” scheint sich zwar auf den ersten Blick nicht als Thema für einen Artikel in einem Blog über Esoterik und Pseudowissenschaft zu eignen. Aber bei genauer Betrachtung ist “Mars One” genau so ein “Schmarrn” wie Astrologie, Homöopathie und all der andere Unsinn, den ich bisher …