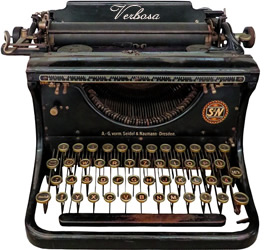CSI: “Wachet auf”
Noch letzte Woche habe ich mir überlegt, in welchen Abständen ich über die neue CSI-Staffel schreiben sollte. Heute allerdings hat die Serie die Frage selbst beantwortet. “Wachet auf” beschreitet einen neuen Weg in der Serie. Zu Beginn finden wir uns im Leichenschauhaus wieder. Zwei tote Frauen liegen nebeneinander auf ihren …