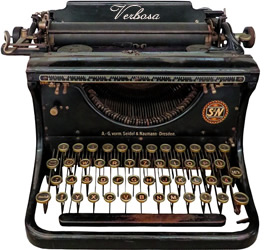“Ich bin ein Hai, holt mich hier raus!”
Im amerikanischen Sprachgebrauch gibt es die Redewendung “to jump the shark” oder auch “shark jumping”. Man verwendet sie im engeren Sinne, wenn man aussagen möchte, dass eine schon seit längerem laufende Fernsehserie ihren Höhepunkt längst überschritten hat und eigentlich am Ende ist, nicht unbedingt von den Zuschauerzahlen, sondern mehr, weil …