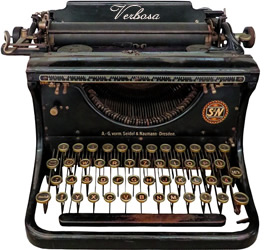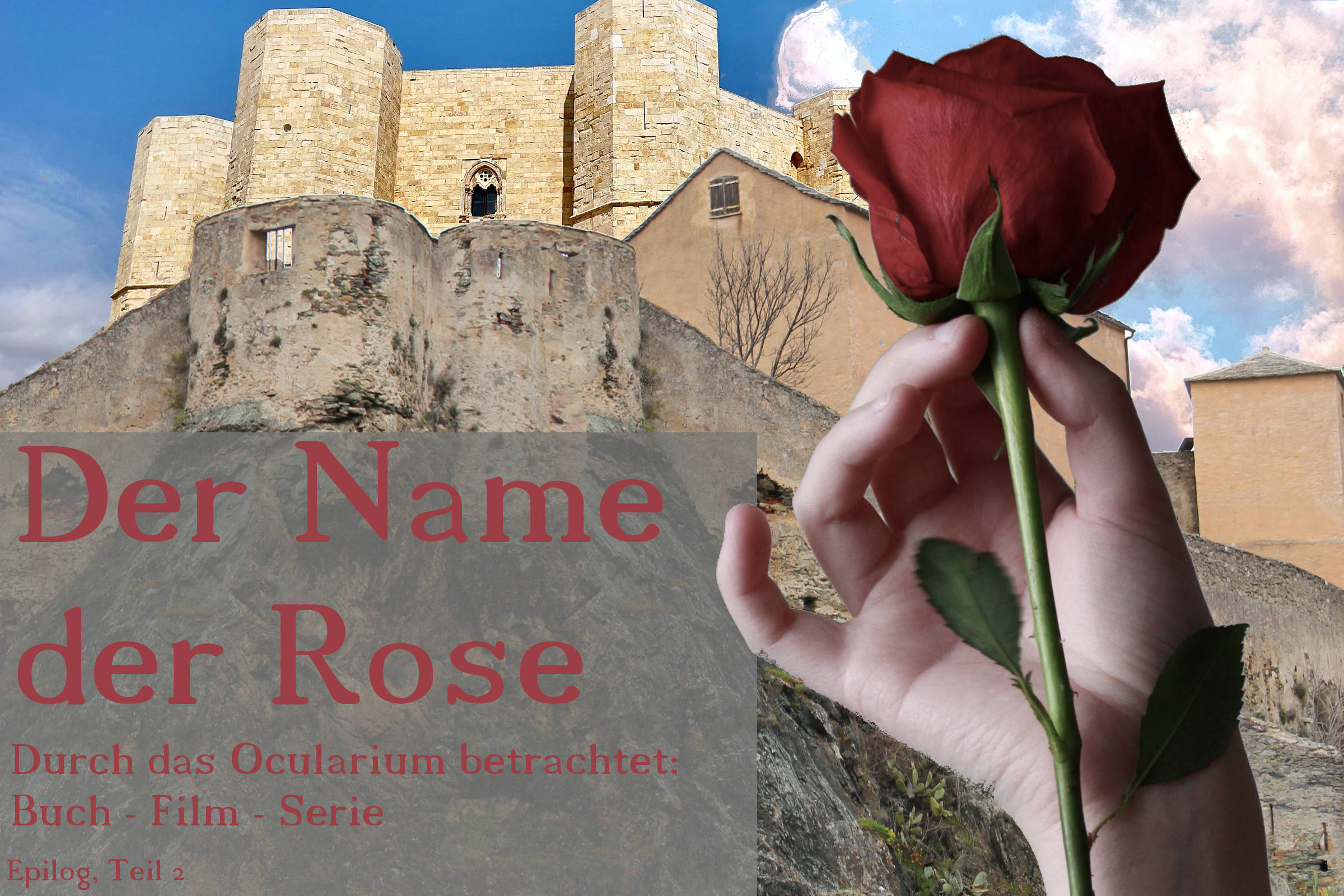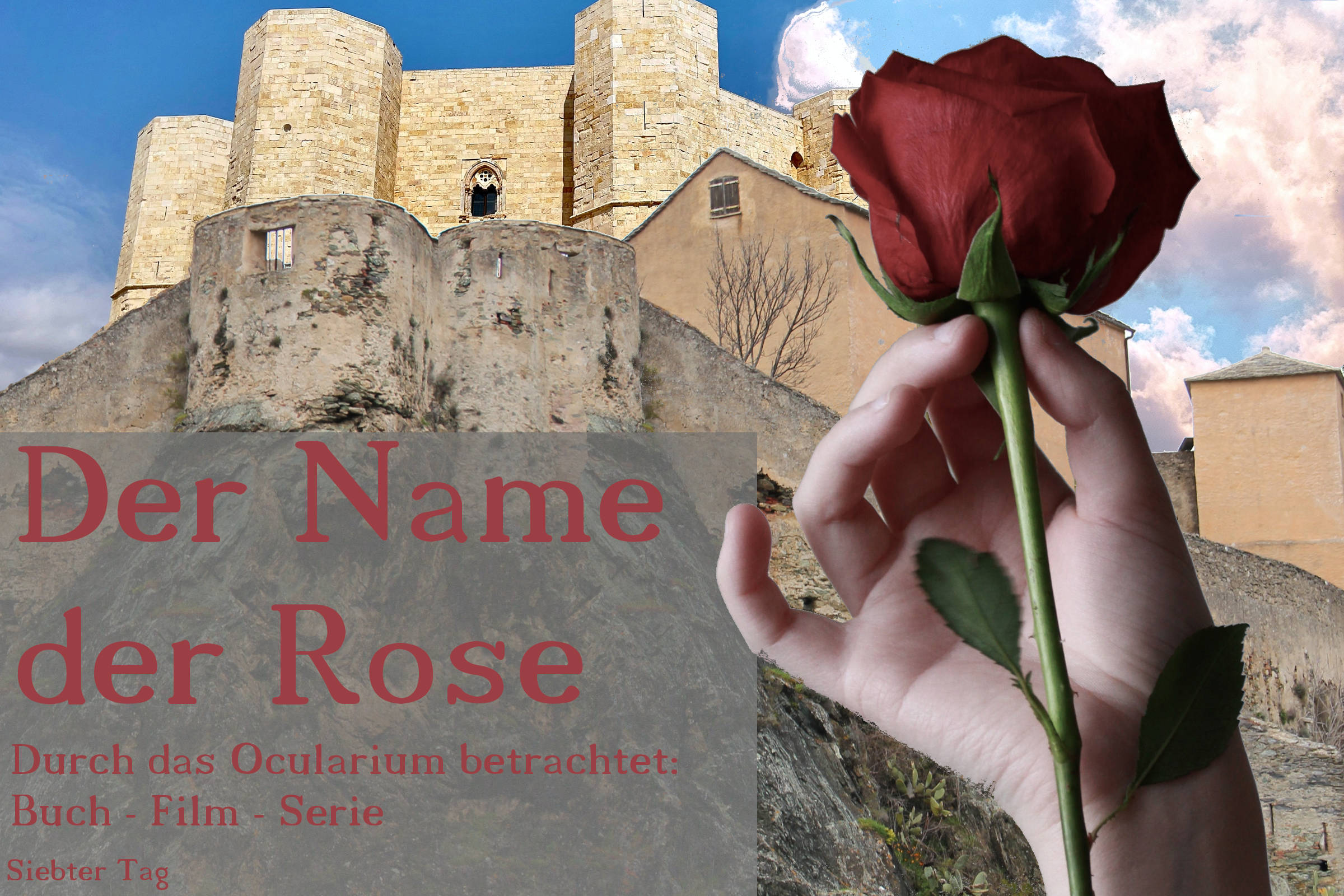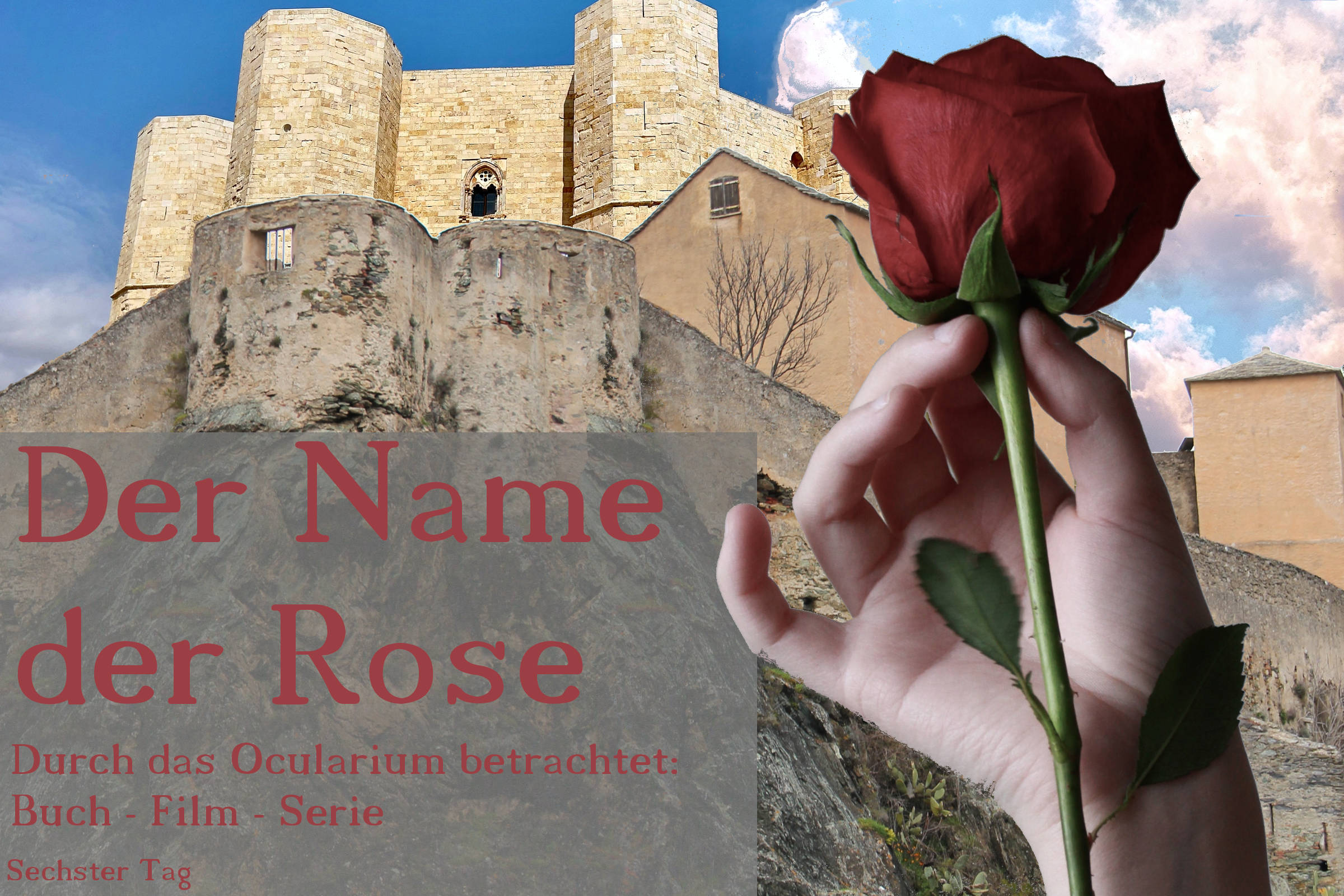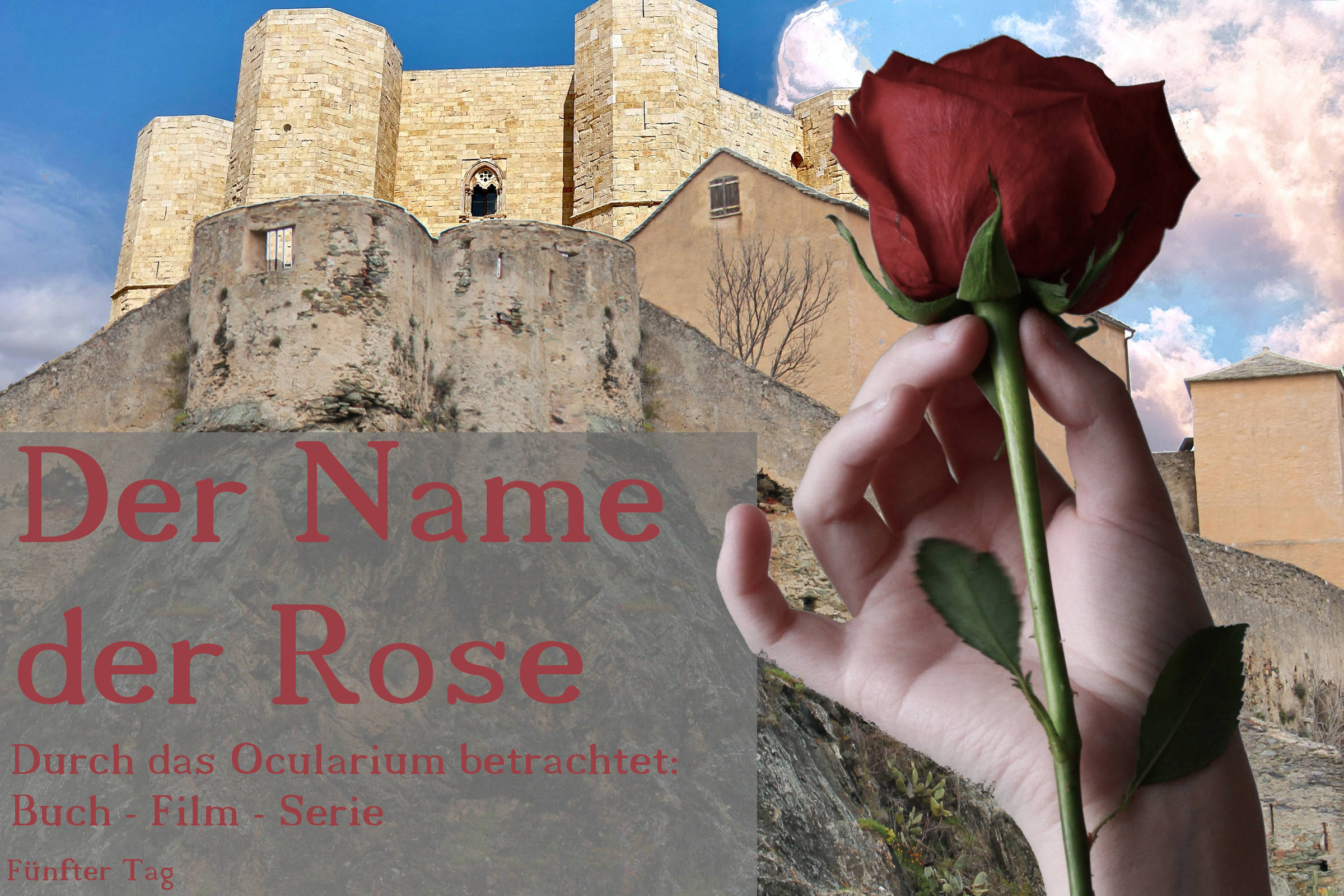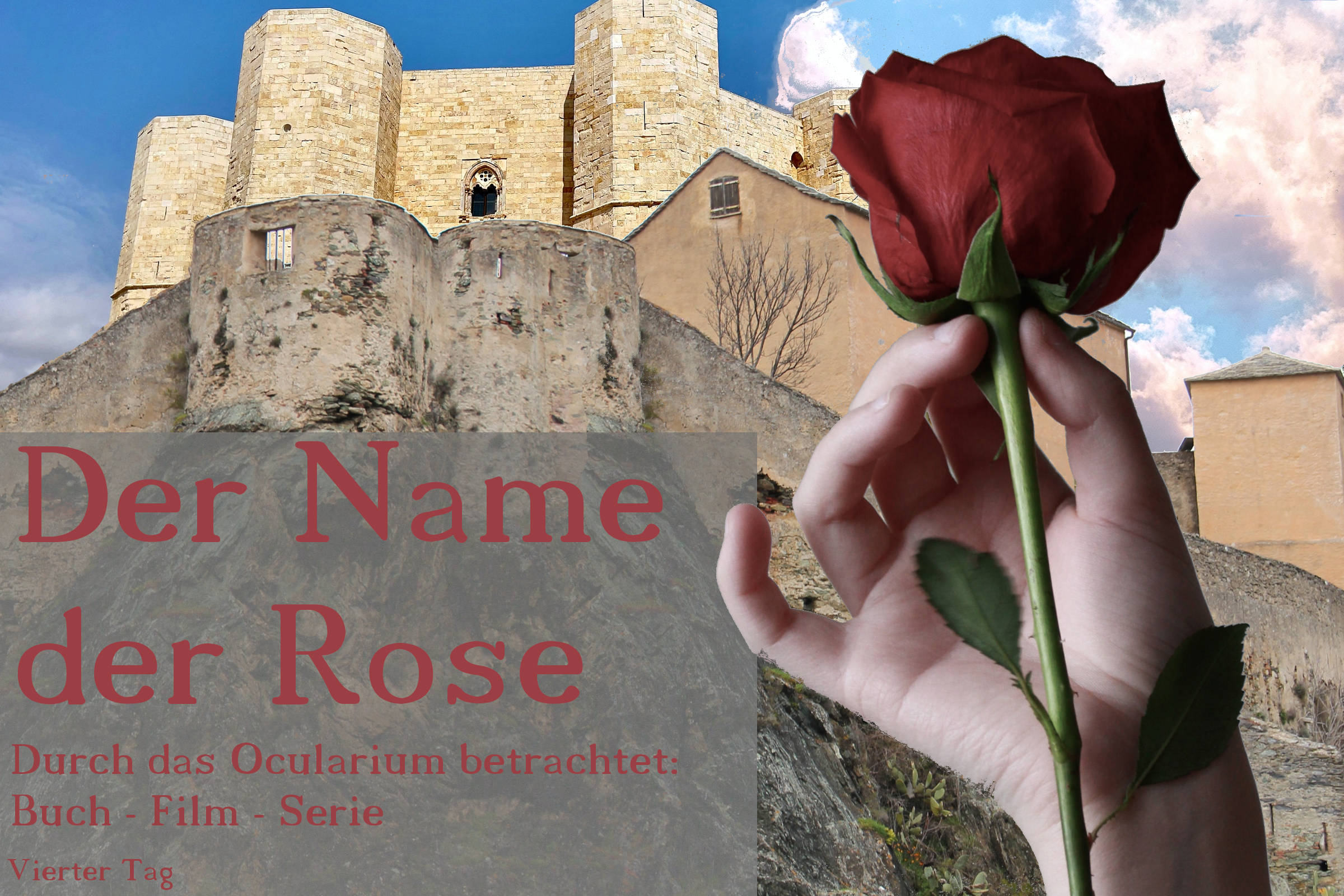Der Name der Rose – Durch das Ocularium betrachtet: Buch – Film – Serie | Epilog Teil 2
Worin noch ein paar Gedanken nachgeliefert werden, die es vielleicht würdig sind, dass sie gedacht werden. Podcast Videokanal Transkript Hatte ich nicht gesagt, die Geschichte “Der Name der Rose” ist vorbei, basta, aus, Amen und so weiter? Ja, richtig, das hatte ich. Seither ist ein bisschen Zeit vergangen und während …