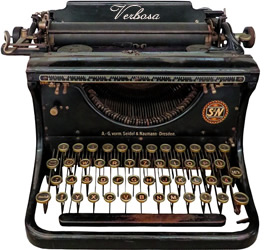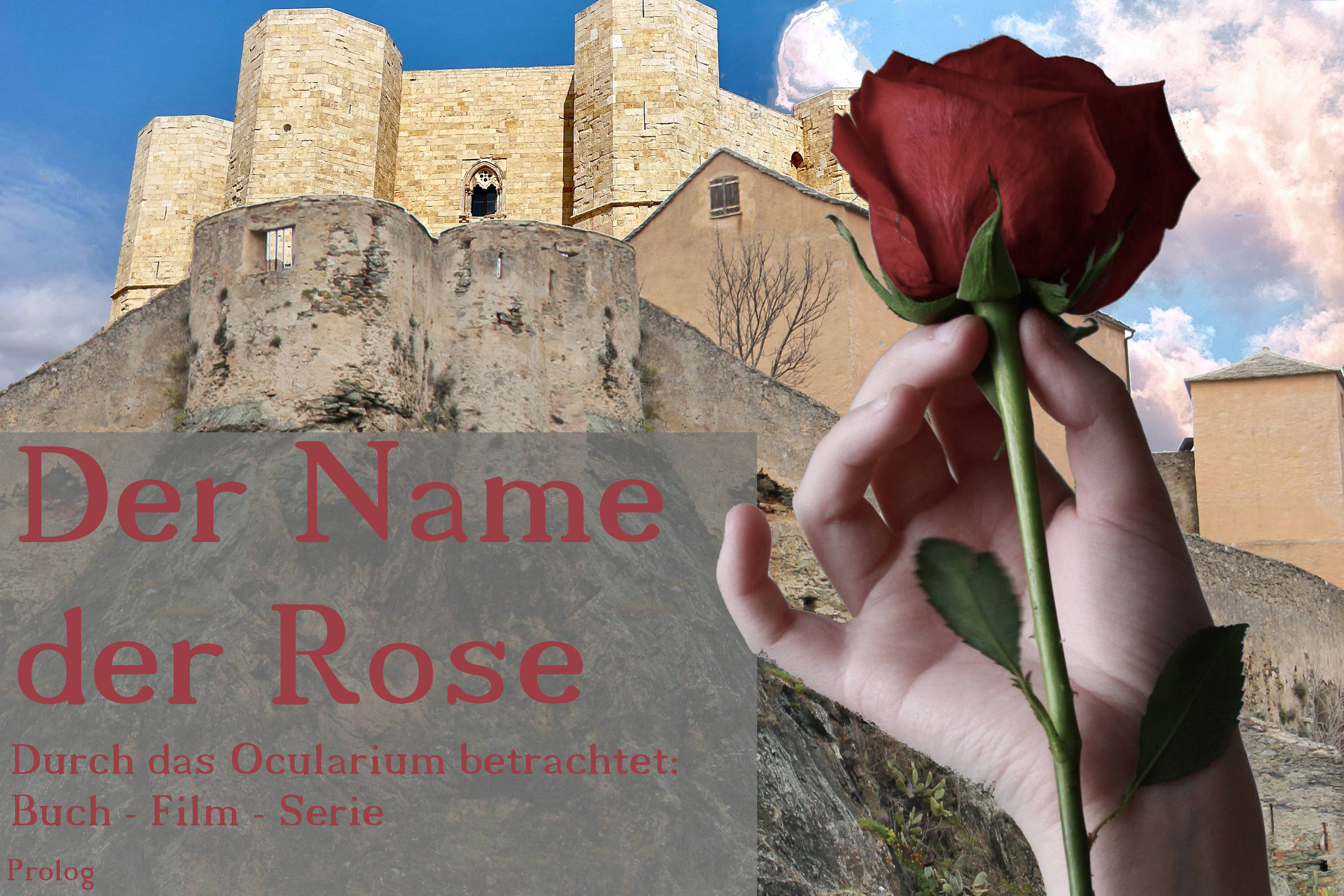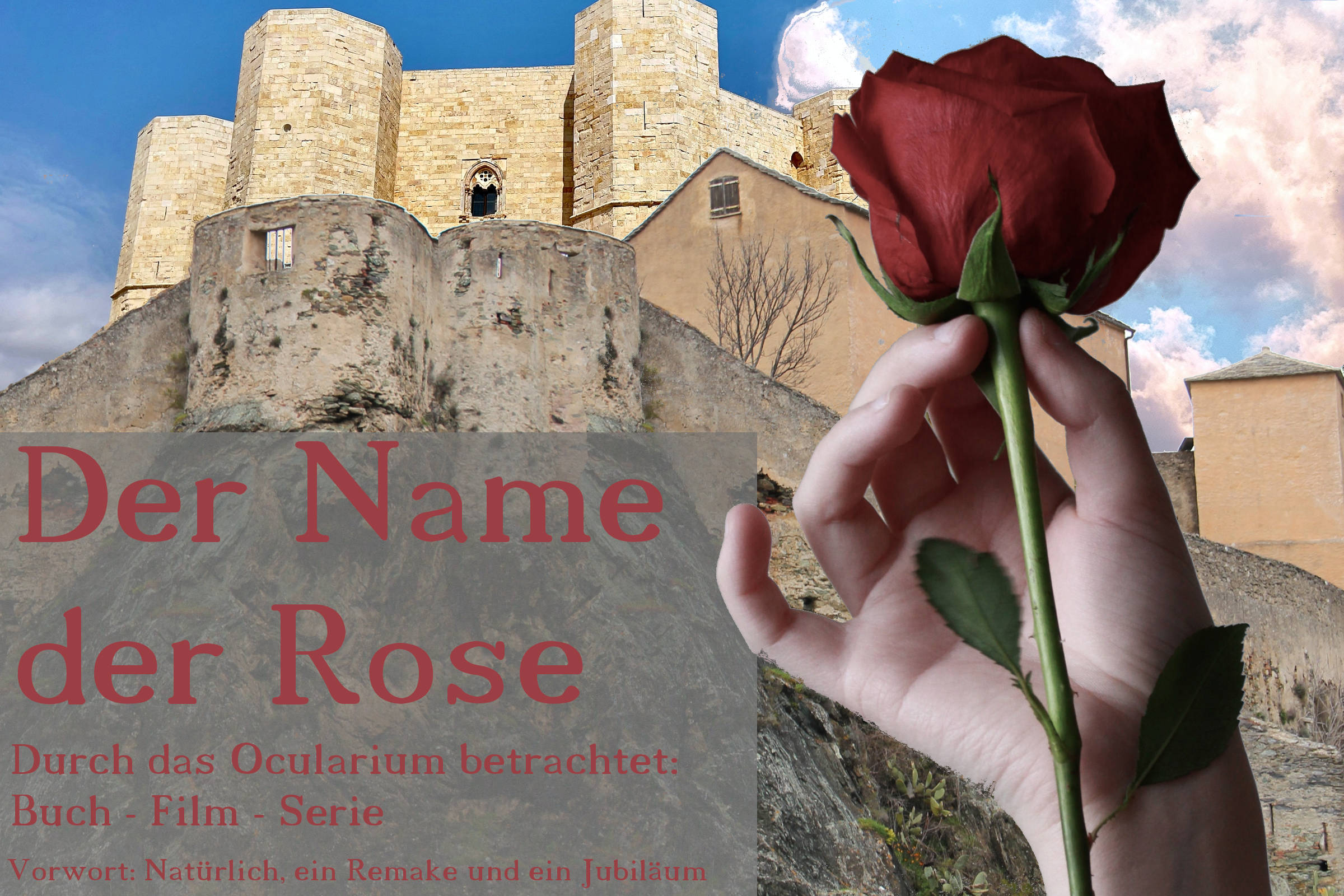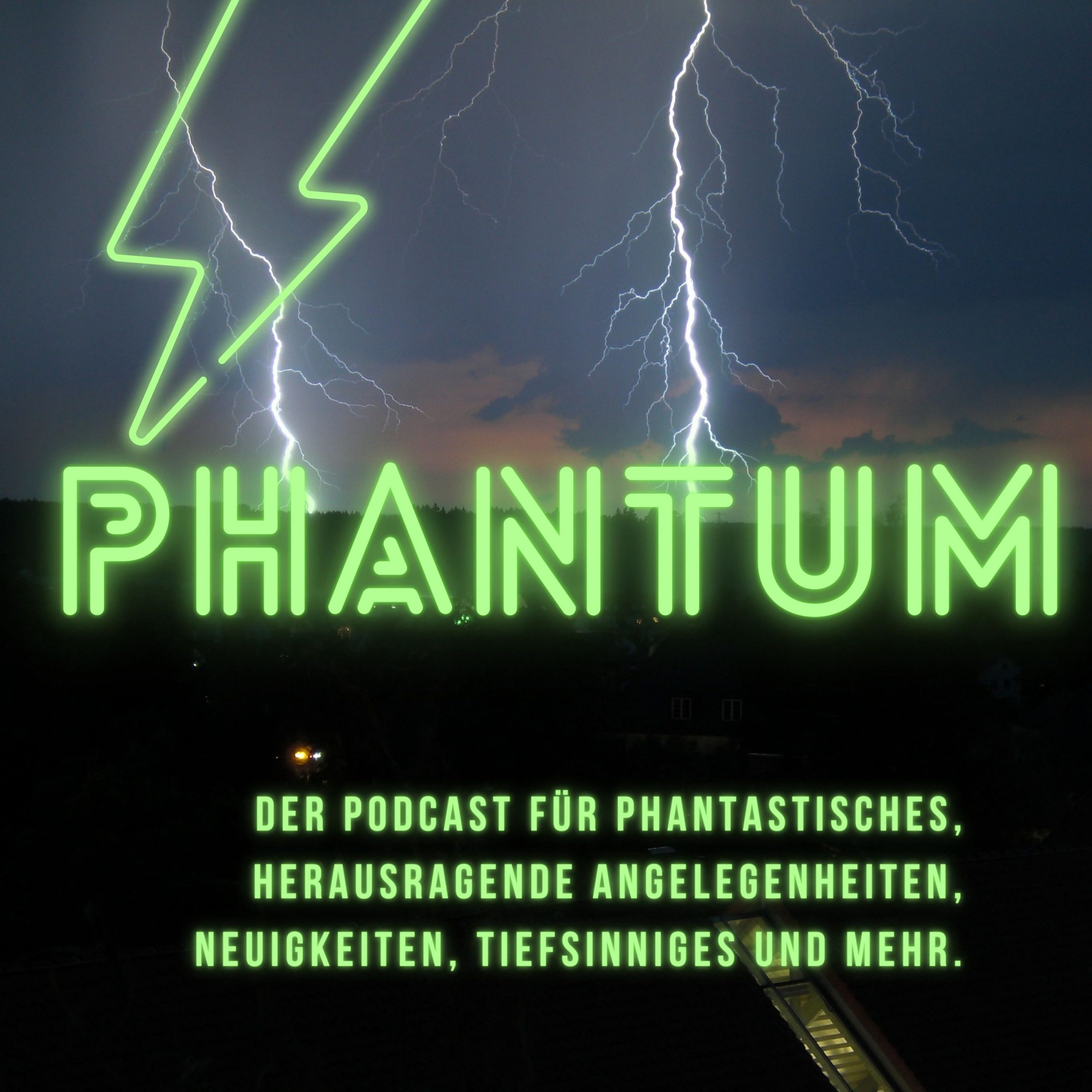Der Name der Rose – Durch das Ocularium betrachtet: Buch – Film – Serie | Prolog
Werbung: “Der Name der Rose” bei AMAZON Bei AMAZON können folgende Versionen von “Der Name der Rose” direkt bestellt werden: Podcast Video Transkript Im Vorwort des Buches “Der Name der Rose” erzählt Umberto Eco die fiktive Geschichte, wie er die Aufzeichnungen eines Mönches gefunden hat, die die Grundlage für die …